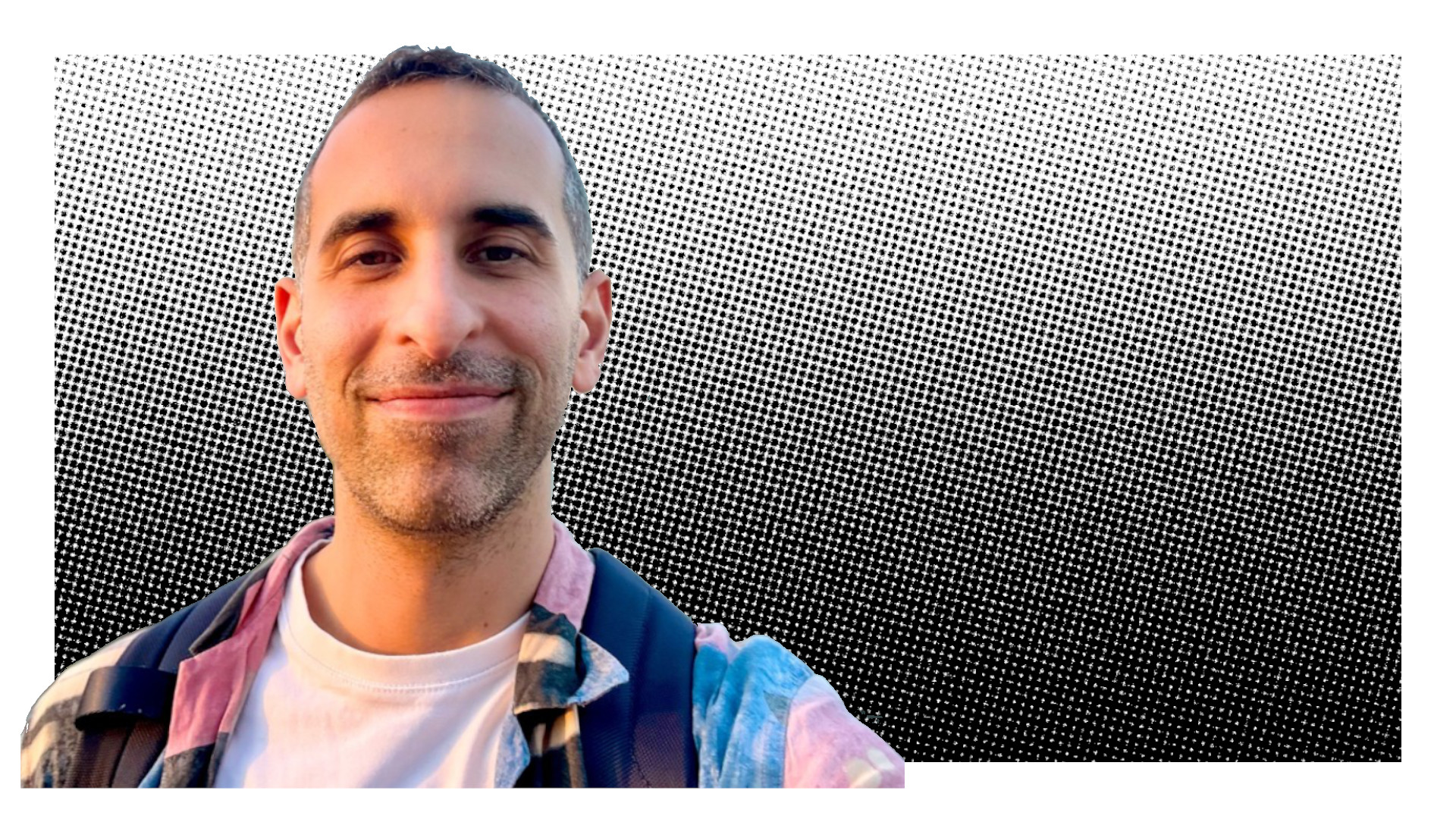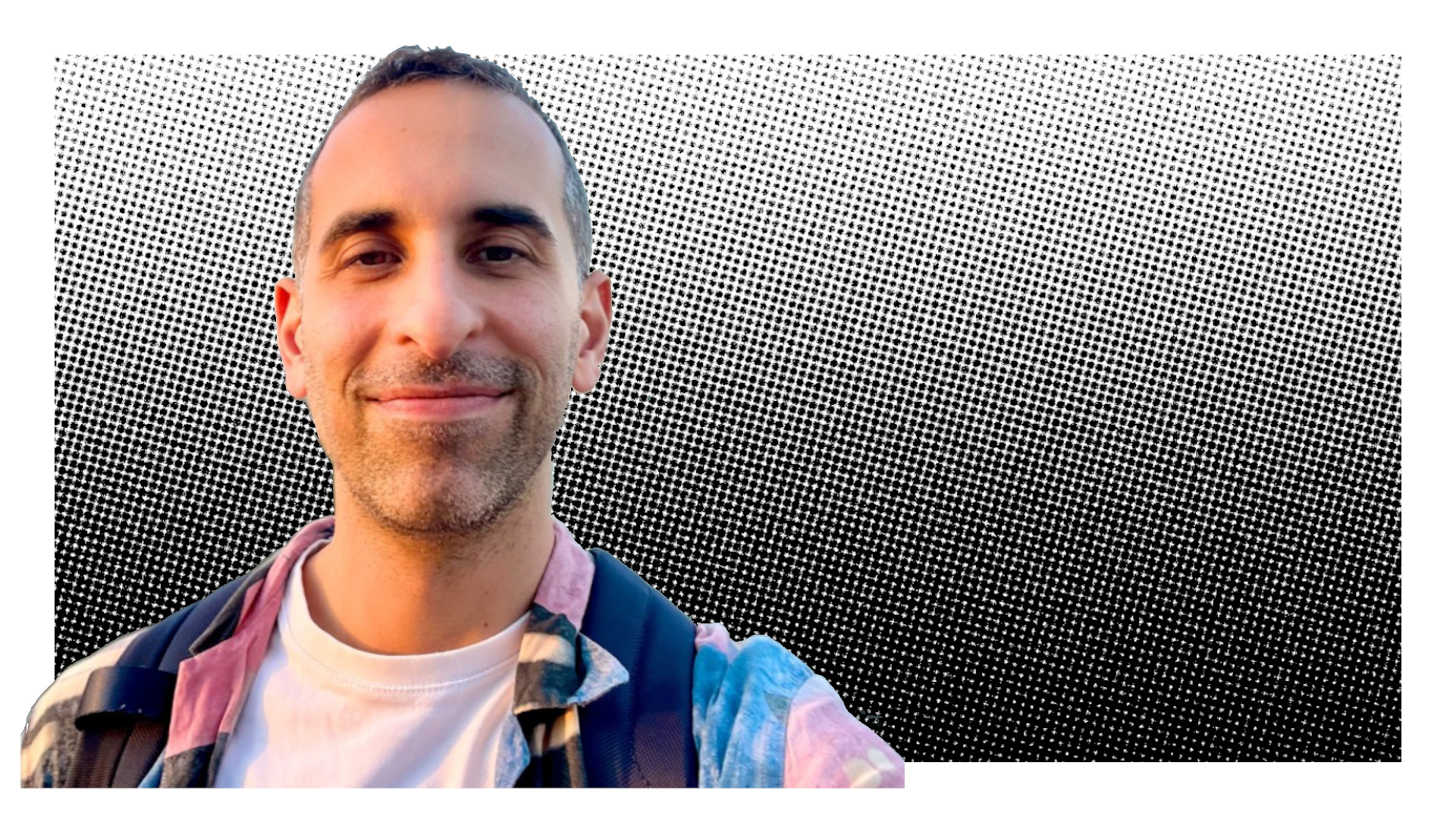Die schwedische Regierung will das Bezahlen für sexuelle Dienstleistungen im Netz unter Strafe stellen. Das werde zu Überwachung, Zensur und Abschreckung führen, warnt Yigit Aydin im Interview. Für den Verband ESWA kämpft er für die Rechte von Sexarbeiter:innen.
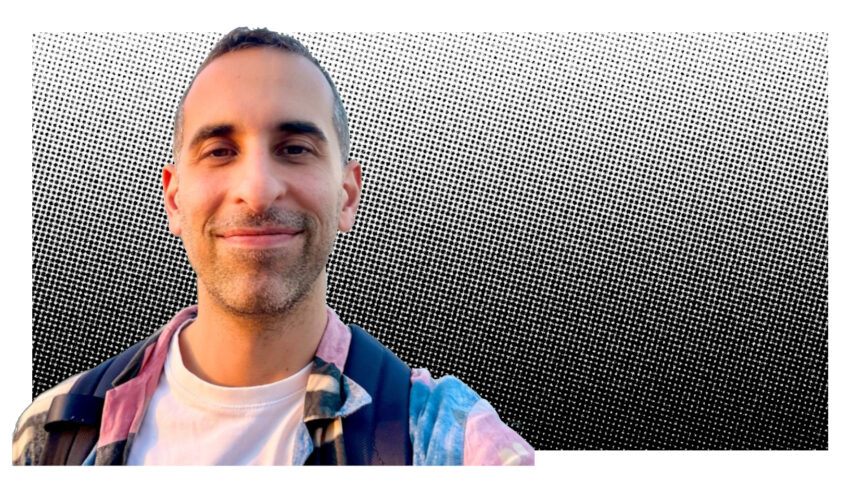 Yigit Aydin kämpft gegen die Kriminalisierung von einvernehmllicher Sexarbeit. – Alle Rechte vorbehalten Foto: Yigit Aydin, Montage: netzpolitik.org
Yigit Aydin kämpft gegen die Kriminalisierung von einvernehmllicher Sexarbeit. – Alle Rechte vorbehalten Foto: Yigit Aydin, Montage: netzpolitik.orgAnderen im Netz gegen Geld beim Masturbieren zuschauen? Das soll in Schweden bald verboten sein. Die konservativ-rechte Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson hat einen Entwurf ins Parlament eingebracht, der das Zahlen für solche sexuelle Dienstleistungen unter Strafe stellt, die „über Distanz, ohne Kontakt ausgeübt werden“. Das Parlament wird voraussichtlich nächste Woche darüber abstimmen.
Es wäre eine Erweiterung des bereits seit den Neunzigerjahren geltenden „Schwedischen Modells“: Sexarbeit selbst ist demnach straffrei, die Kund:innen werden hingegen kriminalisiert. Das soll jetzt nicht mehr nur für physische Kontakte gelten, sondern auch für Online-Dienstleistungen.
Strafbar macht sich laut Entwurf, wer eine Person dazu „verleitet, eine sexuelle Handlung gegen Entgelt vorzunehmen oder zu dulden, um daran teilzunehmen oder sie vorgeführt zu bekommen“. Bloßes Zuschauen beim Ausziehen vor der Kamera wäre damit noch erlaubt; ebenso der Kauf von Porno-Filmen. Wer Models jedoch direkt für „sexuelle Handlungen“ vor der Kamera bezahlt, würde sich strafbar machen. So etwas kann bei Livestreams per Webcam passieren oder wenn man individuelle Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans bestellt.
Yigit Aydin ist Experte für Digitalrechte bei der European Sex Workers‘ Rights Alliance (ESWA), einem von Sexarbeiter.innen geführten Netzwerk, das mehr als 100 Organisationen aus Ländern Europas und Zentralasiens vertritt. Der Verband sammelt derzeit Unterstützer:innen, um das Gesetz noch zu verhindern. Einvernehmliche Sexarbeit zu kriminalisieren schütze keine Sexarbeiter:innen, sagt Aydin im Interview. Er warnt vor verheerenden Folgen, nicht nur für Sexarbeiter:innen und ihre Angehörigen, sondern für sexuelle Angebote im Netz generell. Das Interview wurde auf Englisch geführt und danach übersetzt.
„Das Schwedische Modell drängt Sexarbeiter:innen in unsichere Verhältnisse“
netzpolitik.org: Das geplante Gesetz richtet sich nicht gegen Sexarbeiter:innen, sondern gegen Kund:innen, die für sexuelle Dienstleistungen im Netz bezahlen. Warum fordert ihr Verband, das Gesetz zu stoppen?
Yigit Aydin: Das sogenannte „schwedische Modell“ wird oft als fortschrittlicher Ansatz für Sexarbeit missverstanden. Es behauptet zwar, Sexarbeiter:innen zu entkriminalisieren und nur die Käufer:innen zu kriminalisieren, in der Praxis bestraft es jedoch Sexarbeiter:innen systemisch. Wenn der Kauf einer Dienstleistung kriminalisiert wird, kann diese Dienstleistung nicht mehr auf sichere Weise angeboten werden. Die Sexarbeiter:innen verlieren Kund:innen und Einkommen und werden in Arbeitsverhältnisse gedrängt, die prekär sind oder im Verborgenen ablaufen, wodurch ihr Risiko steigt, Gewalt, Ausbeutung und Isolation zu erleben. Das „schwedische Modell“ beendet die Sexarbeit nicht. Es drängt die Sexarbeiter:innen in unsichere Verhältnisse. Die Vorstellung, dass die Sexarbeiter:innen „nicht kriminalisiert“ werden, ist eine juristische Fiktion.
netzpolitik.org: Wie würde sich das vorgeschlagene Gesetz auf Menschen auswirken, die ihr Geld in Schweden mit Livestreams oder anderen sexuellen Dienstleistungen im Netz verdienen?
Yigit Aydin: Dieses Gesetz kriminalisiert eine der wenigen sichereren und weniger diskriminierenden Formen der Sexarbeit: digitale erotische Arbeit. Es wird Sexarbeiter:innen in Schweden aus einem Sektor verdrängen, in dem sie unabhängig arbeiten, Grenzen setzen können und die Risiken vermeiden, die mit persönlichem Kontakt verbunden sind. Die Folgen werden zweifellos Einkommensverluste für diejenigen sein, die auf digitale Arbeit als Haupt- oder Nebeneinkommensquelle angewiesen sind. Wir werden auch eine zunehmende Isolation sehen, da Kund:innen und Plattformen sich aus Angst zurückziehen werden. Außerdem wird es zu einer verstärkten Stigmatisierung und Überwachung kommen, insbesondere für trans, behinderte, migrierte und rassistisch diskriminierte Sexarbeiter:innen.
netzpolitik.org: Einige schwedische Sexarbeiter:innen haben bereits angekündigt, das Land zu verlassen, sollte das Gesetz in Kraft treten.
Yigit Aydin: Während einige Sexarbeiter:innen versuchen werden, ihre Arbeit ins Ausland zu verlagern oder sich noch stärker durch Anonymität zu schützen, werden andere, die nicht einfach „aussteigen“ oder das Land verlassen können, das Risiko eingehen müssen, unter verschärften strafrechtlichen Bedingungen zu arbeiten.
„Die Durchsetzung wird zu mehr digitaler Überwachung führen“
netzpolitik.org: Auf Plattformen wie OnlyFans und auf Webcam-Seiten bieten Menschen aus der ganzen Welt Inhalte an, die auch in Schweden konsumiert werden. Welche internationalen Folgen könnte das Gesetz haben?
Yigit Aydin: Dieses Gesetz wird weit über Schweden hinaus Auswirkungen haben. Auch wenn die Strafbarkeit national begrenzt ist, werden die von schwedischen Nutzer:innen verwendeten Plattformen weltweit genutzt. Um Haftungsrisiken zu vermeiden, werden Plattformen alle Nutzer:innen in Schweden sperren, einschließlich derjenigen, die nur Inhalte konsumieren. Sie werden Nutzer:innen, die schwedisch aussehen oder schwedische Währung oder Zahlungsanbieter akzeptieren, von ihren Plattformen verbannen oder ihre Inhalte verstecken. Außerdem werden sie ihre Richtlinien zur Moderation von Inhalten verschärfen, das wird Urheber:innen sexueller Inhalte weltweit treffen.
Dieses Gesetz befeuert auch einen internationalen Trend zur Zensur und Überwachung sexueller Inhalte, oft unter dem Vorwand des „Schutzes“ oder der Bekämpfung des Menschenhandels. Das ist repressive Internetpolitik und schadet den digitalen Rechten aller.
netzpolitik.org: Das Gesetz kriminalisiert die Bezahlung für bestimmte Inhalte wie „sexuelle Handlungen“ vor der Kamera, während vorab aufgezeichnete Pornos oder das bloße Zuschauen beim Ausziehen erlaubt bleiben. Wie wird dieses Gesetz Ihrer Meinung nach durchgesetzt werden?
Yigit Aydin: Die Durchsetzung wird unweigerlich zu mehr digitaler Überwachung führen, einschließlich der Überwachung der Online-Kommunikation, Finanztransaktionen, Plattformaktivitäten und möglicherweise sogar privater Nachrichten. Nur so kann man feststellen, ob eine sexuelle Handlung „aus der Ferne durchgeführt“ und „gekauft“ wurde. Die Strafverfolgungsbehörden müssten also Interaktionen untersuchen, die in privaten digitalen Räumen stattfinden – auf Webcam-Seiten, Abo-Portalen, Peer-to-Peer-Chat-Apps oder verschlüsselten Messaging-Diensten.
„Überwachung einvernehmlicher Aktivitäten von Erwachsenen“
netzpolitik.org: Welche Rolle werden Plattformen für sexuelle Dienstleistungen wie OnlyFans dabei spielen?
Yigit Aydin: Plattformen werden wahrscheinlich Nutzer:innen in Schweden sperren oder die Konten schwedischer Content-Creator:innen löschen. Es wird zu einer präventiven Sperrung sexueller Inhalte kommen, die sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht, und zu einer Verschärfung der Nutzungsbedingungen, um selbst anzügliche oder mehrdeutige Inhalte zu verbieten.
Angesichts der vagen Formulierungen des Gesetzes, das sich etwa auf die Frage stützt, ob jemand zu einer Handlung „verleitet“ wurde, könnten Plattformen übervorsichtig werden: durch pauschale Verbote und übermäßige Zensur. Das trifft kleine Creator:innen, Sexarbeiter:innen und marginalisierte Gruppen, die für ihr Einkommen auf diese Plattformen angewiesen sind, unverhältnismäßig hart. Es bedroht auch generell die Freiheit, sich im Netz auszudrücken, da Plattformen einen Anreiz bekommen, Inhalte zu zensieren, statt vor Gericht zu gehen.
Wir gehen auch davon aus, dass dieses Gesetz zu einer verstärkten polizeilichen Überwachung von Plattformen mit Erwachseneninhalten führen wird, zu verdeckten Ermittlungen und Lockvogel-Methoden. Tech-Unternehmen und Zahlungsdienstleister werden unter Druck gesetzt, Nutzerdaten weiterzugeben. Dies hätte eine abschreckende Wirkung auf alle Creator:innen von digitalen Inhalten, die als sexuell anzüglich interpretiert werden könnten. Und es würde für den schwedischen Staat einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, um die Überwachung einvernehmlicher Aktivitäten von Erwachsenen unter dem Deckmantel des Schutzes zu rechtfertigen. Weil die Grenze zwischen Sexarbeit und Pornografie schwammig ist, was die Regierung selbst eingesteht, gibt es ein erhöhtes Risiko von Übergriffen und Fehlinterpretationen.
Schweden will Bezahlung von Camshows kriminalisieren
„Äußerst schädlicher Präzedenzfall“
netzpolitik.org: Die USA haben bereits 2018 in der ersten Amtszeit von Donald Trump ein Gesetz (SESTA/FOSTA) verabschiedet, das Plattformen bestraft, die Sexarbeit ermöglichen. Inwiefern ähnelt das geplante Gesetz in Schweden dem US-Modell?
Yigit Aydin: Der Gesetzentwurf ähnelt SESTA/FOSTA sehr. Beide Gesetze erweitern die strafrechtliche Haftung auf Plattformen und Dritte, die Sexarbeit ermöglichen, stellen sich als Maßnahmen gegen Menschenhandel dar, ohne jedoch zwischen einvernehmlichen und ausbeuterischen Handlungen zu unterscheiden. Dies führt dazu, dass Menschen von Plattformen verdrängt werden; es führt zu Zensur und digitaler Ausgrenzung von Sexarbeiter:innen. Beide Gesetze zielen darauf ab, den Zugang zu Einkommen zu untergraben und Sexarbeiter:innen aus dem Internet in gefährlichere Umgebungen zu drängen, insbesondere für LGBTQI+, rassifizierte und migrantische Communitys.
Der Unterschied besteht darin, dass das schwedische Gesetz ausdrücklich auf digitale sexuelle Handlungen abzielt, die von SESTA/FOSTA nur indirekt betroffen waren. Schweden geht also noch einen Schritt weiter als die USA, indem es Kund:innen für das Anschauen von Cam-Shows oder das Abonnieren sexueller Inhalte kriminalisiert und damit nicht nur die Transaktion, sondern das Medium selbst unter Strafe stellt. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, wäre Schweden das erste Land der Welt, das die Kriminalisierung von Kund:innen nach dem nordischen Modell ins Digitale ausweitet und damit einen äußerst schädlichen Präzedenzfall schafft.
netzpolitik.org: Welche Folgen hat die Kriminalisierung von Sexarbeit bereits heute für Sexarbeiter:innen in Schweden?
Yigit Aydin: Unsere Mitglieder haben erlebt, dass ihre Ehemänner, Partner:innen oder Mitbewohner:innen wegen Zuhälterei strafrechtlich verfolgt wurden, nur weil sie zusammenleben und sich Kosten teilen. Die Regierung argumentiert, dass jeder, der mit einem Sexarbeiter oder einer Sexarbeiterin zusammenlebt, von den Einkünften aus der Sexarbeit „profitiert“. Das führt zu Razzien, zur Trennung von Familien. Die Realität ist: Das schwedische Modell kriminalisiert Sexarbeiter:innen direkt und indirekt. Die mit dem Modell verbundene Schutzrhetorik ist nicht nur irreführend, sie verschleiert das echte Leid, die Angst und Ungerechtigkeit, die alle jene täglich erleben, die das Modell angeblich schützen soll. Diese Erzählung muss sich ändern.
netzpolitik.org: Was will ESWA nun erreichen?
Yigit Aydin: Unsere Kampagne und unsere gemeinsame Erklärung wurden von über 1.500 Bürgerrechtsorganisationen, Menschenrechtsexpert:innen und Wissenschaftler:innen weltweit unterzeichnet, die die Ablehnung dieses Gesetzentwurfs fordern. Wir rufen die schwedischen Abgeordneten erneut dazu auf, diesen schädlichen Vorschlag in seiner Gesamtheit abzulehnen.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.