Wer in Schweden einen Porno-Clip auf OnlyFans nach eigenen Wünschen bestellt, macht sich künftig strafbar. Das neue Gesetz missachtet Grundrechte wie Berufsfreiheit und sexuelle Selbstbestimmung, führt zu mehr Überwachung – und schadet letztlich allen. Ein Kommentar.
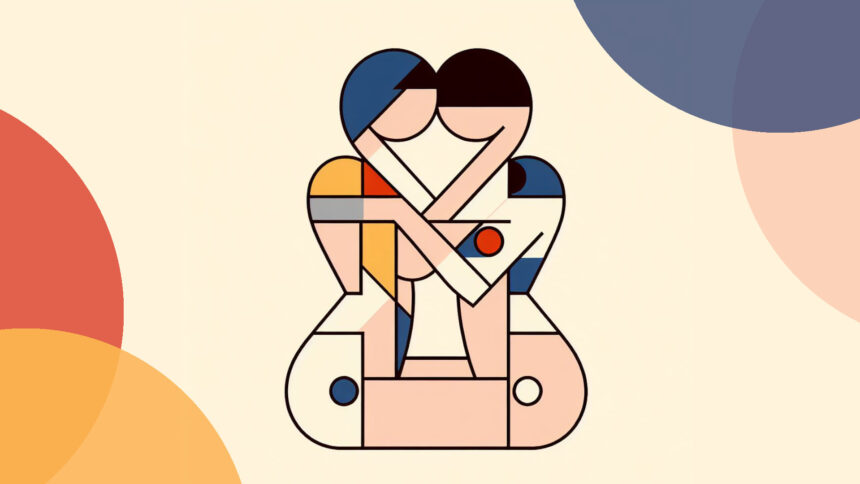 Sexarbeit ist Arbeit (Symbolbild) – Public Domain DALL-E-3 („two persons hugging, bauhaus style reduced minimalist geometric shapes“)
Sexarbeit ist Arbeit (Symbolbild) – Public Domain DALL-E-3 („two persons hugging, bauhaus style reduced minimalist geometric shapes“)Schweden hat seit gestern ein Gesetz, das sich als Lex OnlyFans bezeichnen lässt. Demnach macht sich strafbar, wer für sexuelle Dienstleistungen zahlt, die „über Distanz, ohne Kontakt ausgeübt werden“. Möchte man beispielsweise Aufnahmen bei seinen liebsten Creator*innen via Snapchat oder OnlyFans bestellen und teilt dabei konkrete Wünsche mit, kann man ins Visier der Justiz geraten. Denn das würde nach Logik des Gesetzes eine Person zu einer sexuellen Handlung „verleiten“. Auch eine Plattform wie OnlyFans kann dafür belangt werden, denn sie hätte die Transaktion möglich gemacht.
Vermeintlich soll das den „Schutz vor sexuellem Missbrauch“ zu stärken. Was hier aber tatsächlich passiert: Schweden erweitert sein Sexkaufverbot auf sexuelle Dienstleistungen im Netz und schafft damit einen alarmierenden Präzedenzfall für die Unterdrückung und Marginalisierung von Sexarbeit. Es ist zugleich ein Angriff auf die sexuelle Selbstbestimmung.
Zwei Grundrechte stehen beim gesellschaftlichen Umgang mit Sexarbeit im Vordergrund. Das erste ist die Berufsfreiheit, die es Menschen erlaubt, ihren Beruf frei zu wählen. Viele Sexarbeiter*innen wehren sich gegen das Stigma, den eigenen Beruf angeblich nur unter Zwang auszuüben.
Das zweite Grundrecht ist die sexuelle Selbstbestimmung. Hier geht es darum, dass Menschen selbst über sexuelle Handlungen entscheiden können. Gegner*innen von Sexarbeit führen oft an, dass sich angeblich kein Mensch aus freien Stücken dafür entscheiden könnte, sexuelle Handlungen für Geld anzubieten. Viele Sexarbeiter*innen pochen darauf, dass sie durchaus einen freien Willen haben, den ihnen Außenstehende nicht absprechen können.
„Dieses Gesetz ist kein Schutz, es ist Unterdrückung“
Auch Kund*innen von Sexarbeit haben ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Das Nordische Modell betrachtet sie allerdings vor allem als potenzielle Täter*innen. Nicht als Menschen, die ein Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe und Sexualität haben, und dafür eine einvernehmliche Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten.
Diese Form des Staatsfeminismus hat in Schweden Tradition. Gestartet im Namen des Schutzes von Sexarbeiter*innen ist das Nordische Modell in Wahrheit ein Instrument der Unterdrückung. Seit mehreren Jahrzehnten verfolgt Schweden schon diese Politik. Sexarbeit ist demnach immer eine Form patriarchaler Gewalt, vor allem gegen Frauen, egal wie einvernehmlich die Transaktion geschieht. Und vor dieser Gewalt und Ausbeutung gelte es demnach Betroffene zu schützen – auch jene, die diesen „Schutz“ ausdrücklich ablehnen.
Die European Sex Workers‘ Rights Association (ESWA), die sich für die Interessen von Sexarbeiter*innen einsetzt, sieht in dem Gesetz ein Scheitern der schwedischen Demokratie. Auf Englisch kommentiert die NGO: „Dieses Gesetz ist kein Schutz, es ist Unterdrückung“. Eine schwedische Abgeordnete habe angezweifelt, ob die Protestbriefe zu dem Gesetz wirklich von Sexarbeiter*innen stammten, oder eher von Zuhältern. ESWA beschreibt diese Haltung als „offenkundig ignorant, zutiefst beleidigend und gefährlich“. Sie offenbare eine „tiefe Verachtung für die Intelligenz und die Würde von Menschen am Rande der Gesellschaft“ und bestätige „die schlimmsten der paternalistischen Instinkte Schwedens“.
Sexarbeiter*innen haben konkrete Forderungen
Schon jetzt ist gut dokumentiert, wozu der vermeintliche, staatliche Schutz durch das Nordische Modell führt. Probleme wie Ausbeutung und schlechte Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit, die angeblich bekämpft werden sollen, werden durch die Kriminalisierung der Kund*innen nicht eingedämmt, sondern verstärkt. Verbände und Fachleute berichten von noch mehr Stigma, noch mehr Problemen. Auf dem Papier mag das Gesetz nur Käufer*innen bedrohen. In der Praxis trifft es aber natürlich die Sexarbeiter*innen selbst. Sie verlieren ihr Einkommen, ihnen werden Optionen genommen, so zu arbeiten, wie sie es vorziehen. In ihrem Essay für das Verfassungsblog schreibt Juristin Teresa Katharina Harrer von einem „De facto“-Berufsverbot.
In Deutschland hat der „Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen“ (kurz BesD) aufgeschrieben, welche Art von staatlichem Schutz sich Sexarbeiter*innen stattdessen wünschen. Unter anderem eine Krankenversicherung durch die Künstlersozialkasse, Arbeitsvisa für Sexarbeitende aus Drittstaaten oder eine Aufnahme von Sexarbeit ins Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Menschen vor Diskriminierung schützt. Denn ja: Sexarbeiter*innen sind eine marginalisierte und diskriminierte Gruppe in der Gesellschaft – und Gesetze wie das Nordische Modell sind Ausdruck dieser Diskriminierung.
Dieses Modell jetzt auch noch ins Internet auszuweiten, also auf sexuelle Handlungen „aus der Ferne“, wird für Sexarbeiter*innen nichts verbessern. Die konkreten Folgen beschrieb jüngst Yigit Aydin von der ESWA im Interview mit netzpolitik.org: Betroffene würden ihre Accounts verlieren, ihre Inhalte würden noch mehr von Online-Plattformen verdrängt. Um über die Runden zu kommen, müssten sie sich andere, womöglich gefährlichere Optionen suchen müssen. Unterm Strich verstärkt das die Entwicklungen, die Sexarbeiter*innen im Netz bereits kennen, wenn Plattformen wie Twitter und Instagram ihre Profile löschen oder Zahlungsdienstleister wie PayPal ihnen ihre Dienste verwehren.
„Dieses Gesetz wird weit über Schweden hinaus Auswirkungen haben“
Überraschung: Sexarbeit ist Arbeit
Verfechter*innen des Nordischen Modells führen gerne an, dass Sexarbeit selbst bei guten Arbeitsbedingungen anstrengend und fordernd sein kann. Dass auch Sexarbeiter*innen Tage haben, an denen sie lieber Urlaub machen würden. Gegenfrage: Auf welche Arbeit trifft das nicht zu? Seit wann muss der Staat sicherstellen, dass Erwerbsarbeit Genuss und Erfüllung darstellt – und welche Branchen müsste sich ein solcher Staat als nächstes vorknöpfen?
Wer aus feministischer Perspektive Menschen in körperlich fordernden Arbeitsverhältnissen schützen möchte, hätte eine Menge Ansatzpunkte. Man könnte beispielsweise etwas tun für Menschen, die sich in der Pflege oder Gebäudereinigung den Rücken kaputt machen oder sich in Kitas bis zum Burn-out abarbeiten. Die staatlichen Maßnahmen wären dann aber keine Kriminalisierung von Kund*innen, sondern bessere Arbeitsbedingungen, besseres Einkommen, bezahlbarer Wohnraum.
Nein, Sexarbeit ist keine feministische Utopie, weder online noch offline. Sie hat wenig mit Emanzipation zu tun. Das muss sie aber auch nicht. Sie ist eine Form von Arbeit in einer Welt, in der Menschen eben ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um Geld zu verdienen und sich versorgen zu können. Und idealerweise können sie ihren Beruf dabei frei wählen.
Für einige Menschen ist Sexarbeit eben die beste Möglichkeit unter vielen – mehr oder weniger anstrengenden –Möglichkeiten im Kapitalismus, und sie entscheiden sich, diese zu nutzen. Damit sind sie Teil einer Gig-Economy, die gewisse Formen von Selbstständigkeit und Flexibilität verspricht und zugleich wenig Absicherung bietet.
Vorwand für staatliche Überwachung
Wer Seiten wie OnlyFans oder StripChat losgelöst von sonstigen gesellschaftlichen Verhältnissen betrachtet und primär als Orte der Unterdrückung zeichnet, aus denen Sexarbeiter*innen befreit werden müssen, der erliegt entweder einem Irrtum – oder verfolgt andere, politische Ziele. Gerade für letzteres gäbe es durchaus Anreize. Ein Gesetz wie das in Schweden gibt Behörden Anlass und Befugnisse, digitale Kommunikation und Zahlungsströme zu überwachen, auf der Suche nach strafbaren Online-Sexkäufen. Vor diesem Szenario warnt etwa auch die Organisation ESWA.
Es wäre ein weiteres Beispiel für die Ausweitung staatlicher Überwachung im Netz, die den Schutz einer vulnerablen Gruppe zum Vorwand nimmt. Wir kennen das Spiel von Chatkontrolle & Co.
Die langjährige Erfahrung, wie Staaten mit Online-Überwachungsbefugnissen umgeht, zeigt: Sobald Daten erst einmal in Reichweite sind, wecken sie Begehrlichkeiten, auch über den ursprünglichen Zweck hinaus. Die Verlierer*innen solcher Gesetzgebung sind damit nicht nur Anbieter*innen und Kund*innen von Sexarbeit, sondern alle, die sich ein Internet ohne ständige Überwachung wünschen.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.







