Parteivorsitz ade: Saskia Esken zieht sich zurück, Co-Parteichef Lars Klingbeil kriegt intern den Ärger der Basis ab. Da kommt noch einiges auf die SPD zu.
Die Moderatorin hält kurz inne, schaut verblüfft, fast verlegen – ganz so, als hätte auch sie diese klare Aussage nicht erwartet. Nicht zu diesem Zeitpunkt, nicht so geradeaus.
"Ich gebe mein Parteivorsitzendenamt auf und mache Platz für die Erneuerung", sagt Saskia Esken am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" in der ARD. Kurze Stille im TV-Studio – und Einspieler ab.
Das monatelange Rätselraten und Raunen in der SPD, ob die intern umstrittene Parteivorsitzende weiter im Amt verbleiben will, ob der anhaltenden Kritik im Zweifel auch verbleiben kann, nimmt damit ein jähes Ende. Esken zieht den Schlussstrich unter eine zunehmend hämische und scharf geführte Diskussion über ihre Person. Nicht ausgeschlossen, dass sich die Debatte deswegen an anderer Stelle weiterdreht.
Saskia Esken, die Ermöglicherin
Zuletzt war es einsam geworden um Esken, die 2019 als erste SPD-Vorsitzende von der Basis an eine Doppelspitze gewählt wurde, und deren öffentliche Wirkung von vielen Genossen immer wieder kritisch kommentiert wurde. Erst hinter vorgehaltener Hand, dann öffentlich.
Monatelang wurden Namen über die Flure im politischen Berlin geraunt, wer auf Esken folgen könnte: trittfester im Auftritt, beliebter in der Partei, erfolgreicher im Wahlkreis. Es folgten Schmutzeleien, wie etwa eine durchgestochene Urlaubsreise Eskens während der Koalitionsverhandlungen. Schließlich ätzte ihr eigener Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, dass Esken nicht zu den Top-Kandidaten für das SPD-Kabinett gehöre.
Die öffentliche Kritik begleite sie, seitdem sie ihre Kandidatur für den Parteivorsitz bekanntgegeben habe, sagt Esken selbst dazu, und habe möglicherweise damit zu tun, dass sie "als Linke und einigermaßen unerschrockene, angstfreie Frau den Mund aufmache, wenn es ungerecht zugeht im Land". Das passe manchen vielleicht nicht, glaubt die 63-Jährige. Ihre Entscheidung, sich zurückzuziehen, sei "gereift".
Allzu viele Gedanken mache sie sich darum nicht, sagt Esken. "Mir geht es darum, dass die SPD jetzt nach dieser Wahlschlappe deutlich machen kann, wir haben viele junge, neue Gesichter", sagt Esken, die ihr Bundestagsmandat behalten will.
Esken, die Ermöglicherin: Diese Erzählung soll hängen bleiben, wird jedoch konterkariert von ihren Verhinderern und nur rar gesäten Fürsprechern. Für Lars Klingbeil, der die Debatte um Esken kürzlich als "beschämend" bezeichnet hatte und einen "Stil" kritisierte, "den ich in der SPD überhaupt nicht mag", kann daraus noch ein handfestes Problem erwachsen.
Denn abgestellt bekommen hat er ihn nicht. Und schon kurz vor Eskens Rückzug musste sich ihr SPD-Co-Chef harte Kritik gefallen lassen.
Unruhe in der SPD
Bei den Landesparteitagen in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) und auf Husum (Schleswig-Holstein) am Wochenende warfen ihm insbesondere junge Delegierte eine "Abstrafung" von Esken vor, während Klingbeil selbst Ämter anhäufe und seine Macht ausbaue. Der "Tiefpunkt der Partei" dürfte nicht zum Höhepunkt der Karriere von Einzelnen sein, mopperte etwa Luana Marsau, die stellvertretende Juso-Vorsitzende in Schleswig-Holstein. Auch wurde Klingbeil vorgeworfen, keine programmatische Vision für die Partei zu haben.
Dass dieser Eindruck entstanden ist, liegt auch an Klingbeils Agieren in den Wochen nach der Wahlniederlage. Er hat die SPD auf sich zugeschnitten, ist nun Vizekanzler und Finanzminister im schwarz-roten Kabinett – während andere Genossen mit Ambitionen leer ausgegangen sind, Esken inklusive. Klingbeil hat machtpolitisches Geschick bewiesen, für manche Genossen dabei aber zu wenig Demut an den Tag gelegt und die Debatte um Saskia Esken, wie auch die um die SPD-Kanzlerkandidatur im vergangenen November, sträflich laufen lassen.
Auch er habe Fehler gemacht, räumte Klingbeil in Duisburg ein. Darüber müsse man reden. Wie ernsthaft, wie belastbar, wie schonungslos – das wird nicht zuletzt die Aufarbeitung des Wahlergebnisses durch eine eingesetzte Kommission zeigen müssen. Ebenso, wie engagiert diese Analyse von der Parteispitze vorangetrieben wird. Das im Umfeld der Wahl eine vergiftete Debatte über die eigene Co-Vorsitzende geführt wurde, dürfte nicht zu den Glanzmomenten gehört haben.
Nicht zuletzt wird Klingbeil auf dem vorgezogenen Parteitag Ende Juni den Delegierten eine einleuchtende Erklärung dafür geben müssen, warum er – wie erwartet wird – erneut als SPD-Vorsitzender kandidieren möchte. Nur zu betonen, dass es eine starke Stimme für die SPD am Kabinettstisch brauche, dürfte nicht alle überzeugen. Zumal Esken die Erneuerung der Partei mit ihrem Rückzug in letzter Konsequenz vorantreibt – jene Erneuerung, die Klingbeil ausgerufen hat. Qua Amt verantwortlich für die historische Niederlage bei der Bundestagswahl sind beide.
In der SPD wird damit gerechnet, dass schon bald eine Nachfolgerin für Esken ihr Interesse an den Parteivorsitz anmelden könnte: Bärbel Bas, die neue Arbeits- und Sozialministerin. Erst kürzlich hatte die frühere Bundestagspräsidentin betont, dass sie den Parteivorsitz nicht ausschließe – aktuell aber kein Platz frei sei. Das kann man als Wink mit der Dachlatte verstehen. Die Duisburgerin gehört wie Esken dem linken Parteiflügel an.
Zwar war auch dort der Rückhalt für Esken zuletzt erodiert, die Rolle der scheidenden SPD-Co-Vorsitzenden sollte dennoch nicht unterschätzt werden. Sie fungierte als Scharnier zum linken Flügel, Klingbeil gehört der konservativ-pragmatischen Strömung in der SPD an. Sie gilt als harte Verhandlerin, als eine, die die Parteibasis im Blick hat. Ein 500-Milliarden-Euro-Programm für Investitionen schlug sie mit ihrem damaligen SPD-Co-Chef Norbert-Walter Borjans schon 2019 vor.
Eskens Rückzug zeigt, dass sich die SPD nach der Wahlniederlage noch sortiert; sortieren muss und wichtige Debatten während der schwarz-roten Regierungsbildung verschleppt wurden. In den nächsten Wochen dürfte es daher kaum ruhiger zugehen.

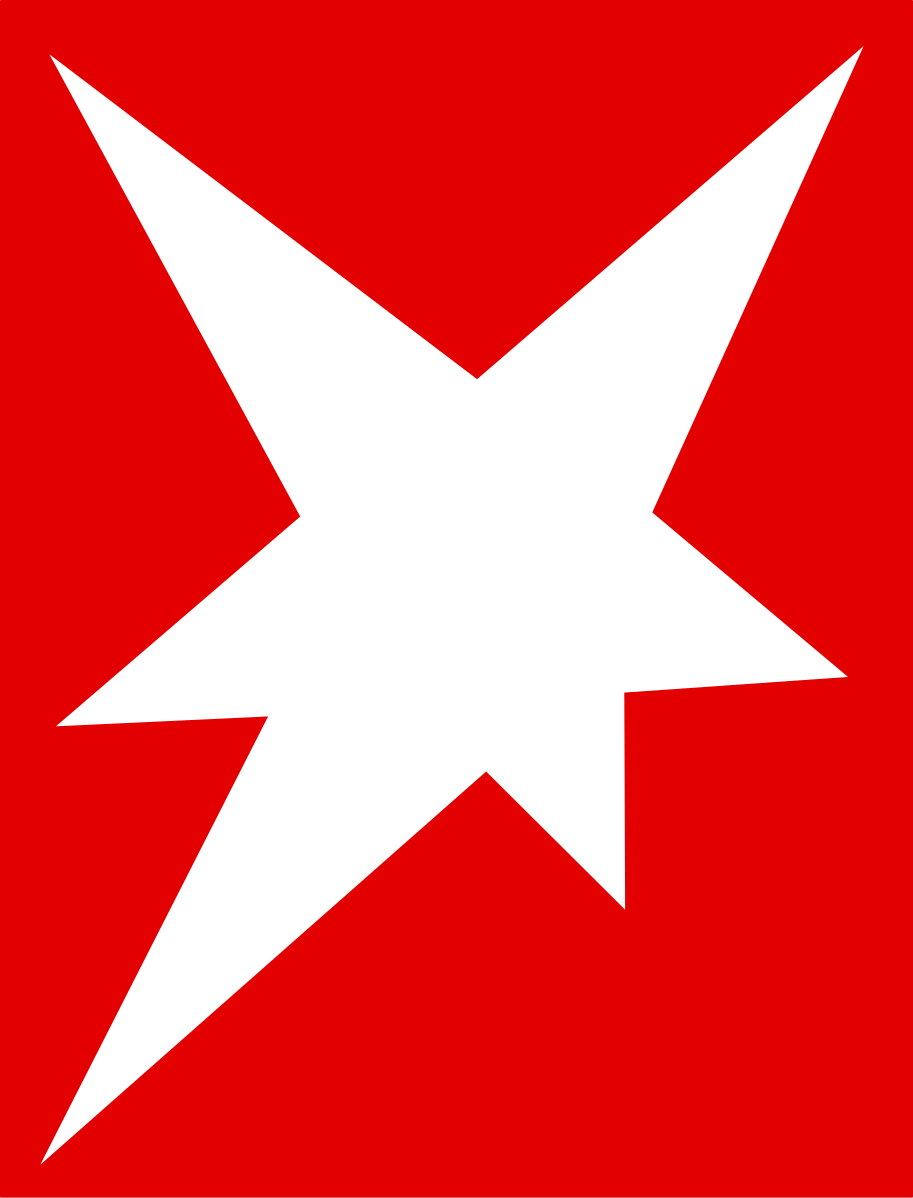 7 hours ago
7 hours ago 





