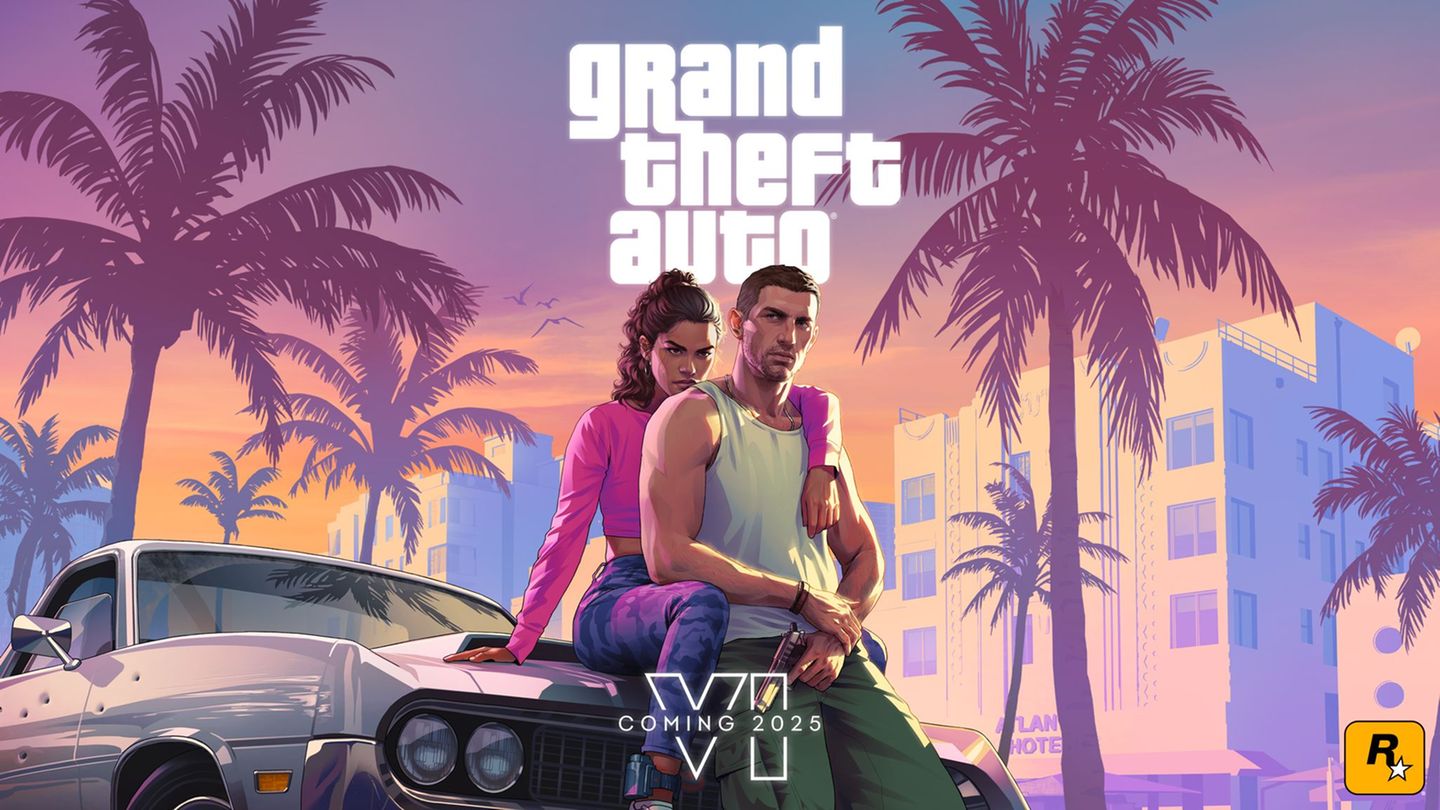Mit Thorium statt Uran als Brennstoff führt China die Kerntechnologie an. Flüssigsalzreaktoren bieten Sicherheit, Effizienz und eine Zukunft mit grünem Wasserstoff.
Hat Atomstrom eine Zukunft? Weltweit geht der Anteil von nuklear erzeugter Energie zurück – doch China experimentiert mit einem Reaktortyp, der im Westen erforscht, aber in seiner Entwicklung aufgegeben wurde: Thoriumreaktoren. Diese Kraftwerke nutzen statt Uran das Element Thorium. Während heutige Atomkraftwerke meist mit dem Isotop Uran-235 betrieben werden und Uran im allgemeinen Bewusstsein oft mit Kernspaltung gleichgesetzt wird, ist es nicht das einzige Schwermetall, das enorme Energiemengen durch Kernspaltung freisetzen kann.
China nimmt alte Forschungen wieder auf
Seit 2011 treibt China die Idee eines Thoriumreaktors voran. Im vergangenen Jahr wurde ein experimenteller Zwei-Megawatt-Reaktor in Betrieb genommen. Der Bau des Versuchsreaktors in der Wüste Gobi begann 2018; nur sechs Jahre später war das neuartige System einsatzbereit. Im Juni 2024 erreichte es seine volle Leistung. Den Chinesen gelang ein weiterer Meilenstein: Sie konnten den Reaktor mit neuem Brennstoff nachladen, ohne ihn zuvor herunterzufahren – ein Schritt, der bei herkömmlichen Reaktoren unerlässlich ist.
Dieses Nachladen im laufenden Betrieb ermöglicht einen nahezu ununterbrochenen Betrieb über die gesamte Lebenszeit des Reaktors. Xu Hongjie, Leiter des Projekts, erklärte: "Wir stehen jetzt an der Spitze der globalen nuklearen Innovation." Derzeit entsteht in Gansu ein 10-Megawatt-Demonstrationsreaktor, der bis 2030 Strom und Wasserstoff erzeugen soll. Im Westen forschen Firmen wie Core Power an schwimmenden Thoriumreaktoren, bleiben aber hinter China zurück.
Die Asiaten knüpfen an Forschungen aus den 1950er- und 1960er-Jahren an. Damals hoffte man, auf Basis von Thorium kompakte Reaktoren entwickeln zu können, die strategische Kampfbomber mit praktisch unbegrenzter Reichweite antreiben könnten. Während des Kalten Krieges investierten die USA fast eine Milliarde Dollar in die entsprechenden Flüssigsalzreaktoren. Der erste funktionsfähige Flüssigsalzreaktor am Oak Ridge National Laboratory lief von 1965 bis 1969 über 13.000 Stunden. Doch das Interesse des Energieministeriums erlahmte, und Anfang der 2000er-Jahre kam die Entwicklung zum Stillstand. "Die USA haben ihre Forschung öffentlich zugänglich gemacht und auf den richtigen Nachfolger gewartet. Wir sind dieser Nachfolger", so Xu.
Die Vorteile von Thorium
Thorium-232 ist selbst nicht für eine Kernspaltung geeignet; es dient als Ausgangselement. Durch Neutronenbeschuss verwandelt es sich in Protactinium und anschließend in Uran-233. Dieser Prozess nutzt Neutronen aus einer initialen Spaltungsreaktion, wobei Protactinium entfernt wird, um Verluste zu minimieren. Der Zerfall von Uran-233 setzt Energie frei, und der Prozess erzeugt zugleich neuen Brennstoff aus Thorium, wodurch eine dauerhafte Reaktion entsteht. Ein "gefrorener Salzpfropfen" am Reaktorboden schmilzt bei Überhitzung, lässt das Salz in eine Kühlkammer fließen und stoppt die Reaktion, was Kernschmelzen verhindert.
Reaktortyp ohne Unfälle
Neben dem Brennstoff Thorium zeichnet sich der Reaktor durch die Verwendung von flüssigem Salz statt Wasser als Kühlmittel im primären Kreislauf aus. Besonders in Sachen Sicherheit bieten Schmelzsalzreaktoren klare Vorteile: Bei einer Beschädigung würde in konventionellen Kraftwerken radioaktiv verseuchter Wasserdampf entweichen, in die Atmosphäre gelangen und sich weiträumig verteilen. Geschmolzenes Salz hingegen bleibt nur bei sehr hohen Temperaturen flüssig. Tritt es durch einen Defekt aus, kristallisiert es sofort zu Salzbrocken. Der Plutoniumgehalt im Abfall ist deutlich geringer als in konventionellen Systemen, was die Abklingzeit auf etwa 300 Jahre reduziert, im Gegensatz zu Tausenden Jahren bei Uranreaktoren. Die hohen Temperaturen ermöglichen zudem die Produktion von grünem Wasserstoff, und Thorium-betriebene Schiffe könnten Emissionen drastisch senken.
Thorium-Flüssigsalzreaktoren bringen spezifische Herausforderungen mit sich. Das Salz greift Dichtungen und Leitungen an; es erfordert spezielle Legierungen wie Hastelloy, einer Nickel-Molybdän-Verbindung. Diese Probleme hätte man vermutlich schon früher lösen können. Kritiker bemängeln, dass Thoriumreaktoren für die USA uninteressant waren, weil sie sich nicht zur Herstellung von Bombenmaterial eignen. Zwar entsteht Uran-233, doch ist dieses weniger explosiv als Uran-235, das in Atombomben verwendet wird. Indien entwickelt ebenfalls Thoriumreaktoren, setzt aber auf Feststoffreaktoren, was die Forschung komplexer macht. Thorium könnte die globale Energiewende durch geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen fördern.
Thorium soll grünen Wasserstoff erzeugen
Günstige Strompreise sind von großer Bedeutung für die chinesische Wirtschaft. Privatkunden zahlen in Peking umgerechnet zwischen sechs und zehn Cent für eine Kilowattstunde – in Deutschland zahlen sie im Durchschnitt 37 Cent. Thoriumreaktoren könnten die Entstehungskosten für Atomstrom in China auf etwa drei Cent pro Kilowattstunde drücken. Das entspricht in etwa den Projektionen für erneuerbare Energien, wobei der Reaktor allerdings eine kontinuierliche Leistung abliefert, die je nach Bedarf gesteigert werden kann.
Thorium ist dreimal häufiger als Uran, und China verfügt über bedeutende Vorkommen. Die Bayan-Obo-Mine könnte das Land 60.000 Jahre mit Energie versorgen. Thoriumreaktoren könnten eine Schlüsselrolle in einer Wirtschaft mit grünem Wasserstoff spielen. Trotz hoher Anfangskosten könnten sie langfristig 20 bis 30 Prozent günstiger als Uranreaktoren sein, da Thorium reichlich vorhanden ist und Abfallentsorgung einfacher ist. Chinas Vorreiterrolle stärkt seine geopolitische Position und unterstützt das Ziel der CO2-Neutralität bis 2060. Auch im Westen wird wieder an Thoriumreaktoren geforscht, doch China liegt derzeit klar in Führung. Xu Hongjie verglich den Wettlauf um die Technologie mit Äsops Fabel "Die Schildkröte und der Hase": "Kaninchen machen manchmal Fehler oder werden faul. Dann nutzt die Schildkröte ihre Chance."